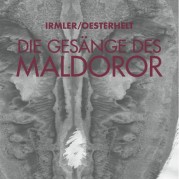Die Gesänge des Maldoror
Die Gesänge des Maldoror
Keine weiteren Auskünfte „Er ist schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch!“ So also müssen wir uns den Leichnam des 24-Jährigen vorstellen, bevor ihn zwei Paar gleichgültiger Hände mit einem Hau-Ruck ins Massengrab wuppen, im November 1870, während der letzten Tage der Pariser Kommune, so berühmt und berüchtigt wie er, wie Lautréamont, Sänger des Bösen. Ach, er hätte sich auch zum Sänger des Guten gemacht, hätte man ihn gelassen, den Erfolglosen, den Unerhörten, den erfolglosen Dichter, den sein Jahrhundert nicht einmal mit Nichtachtung gestraft hat, sondern mit Nichtbeachtung. Alles! Alles nur, um sich Gehör zu verschaffen: „Die Hindernisse in meinem Ohr, sie zerbarsten (…) unter dem Ansturm lärmerfüllter Luft, die sich aus mir heraus Bahn brach. Ein neues Organ, ein neuer Sinn! Ich hatte einen Klang gehört!“ Aber so wie man etwa ein Gesicht nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen mag und den Rest eines langen Lebens damit verbringt, sich an dieses Gesicht zu erinnern, so ist es dieser neue Klang, der Lautréamont sein kurzes Leben lang umgetrieben hat. Sein Verleger, der nichtsnutzige Léon Genonceaux, behauptet, Lautréamont habe „nur des Nachts an seinem Klavier“ geschrieben, „wo er laut deklamierte, wild in die Tasten schlug und zu den Klängen immer neue Verse heraus hämmerte.“ Was hat es da zu hören gegeben? Rhythmen einer Fiebernacht, geträumt als kleines Kind in Montevideo? Die Trommeln für ferne, missverstandene Dreiachtelgötter, geschändete, entwurzelte, entführte Dämonen? Schreie und Flüstern in einer Stadt im permanenten Belagerungszustand, einer Stadt, die den Tod lebt? Ein Vorgriff auf die eigenen letzten Stunden? Ein Klang, für den man immer und immer wieder nur einen Näherungswert findet, aber keine Deckungsgleichheit? Ein paar Jahre später nur werden sich die ersten Wörter einer Maschine entringen, „Mary had a little lamb“, ein Kinderreim, Worte der Unschuld. Die alten Götter werden neu geboren; es wird noch dauern, bis sie wieder brüllen und toben und schreien wie einst in Montevideo, in Paris. Mary had a little lamb. Doch das Lamm wird zur gegebenen Zeit vom Haifischweibchen zerfetzt. Und was erst wird Mary geschehen? Lautréamont versuchte, ein Lied davon singen und es fehlten ihm nicht die Worte, wohl aber die Musik. Diese Musik, eine Musik, stellen Carl Oesterhelt und Hans Joachim Irmler jetzt den „Gesängen des Maldoror“ bei, ein kühn behauptetes 19. Jahrhundert, verwüstet durch das Wissen um das 20. Jahrhundert. Schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf dem Seziertisch." Karl Bruckmaier Eine kammerorchestrale Komposition von Carl Friedrich Oesterhelt und Hans Joachim Irmler. Das verbotenste Buch des 19. Jahrhunderts, Klassiker der schwarzen Romantik erstmals zeitgemäß von Irmler, Oesterhelt, Salewski, dem Modern String Quartett und der Stadtkapelle Scheer musikalisch in Szene gesetzt. Wir, die Stadtkapelle Scheer, Carl Oesterhelt, Musiker und Komponist und Hans Joachim Irmler, Musiker und Betreiber des Faustmusikstudios in Scheer, haben eine Interessengruppe gebildet, weil wir uns gemeinsam mit „moderner Musik“ auseinandersetzen wollen. Wir beschäftigen uns mit der Realisation der 1874 erschienenen Dichtung „Die Gesänge des Maldoror“: das einzige Werk des französischen Dichters Lautréamont übte starken Einfluss auf die Literatur der Moderne und der Surrealismus aus und gilt als eines der radikalsten Werke der abendländischen Literatur. Wir verfolgen die musikalische Umsetzung dieses Gedankenguts, dh. das Werk zu vertonen und zur Aufführung hier in Scheer zu bringen. Studio Konzert am 29. + 30.07.2017
Anmeldung über: reservierung@fauststudio.de oder Abendkasse!
Achtung, begrenzte Platzanzahl!